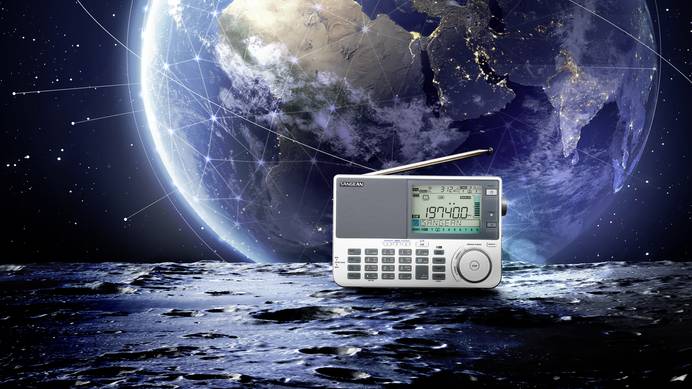Ratgeber
In einer Zeit, in der digitale Medien uns nahezu unbegrenzten Zugriff auf Informationen aus aller Welt bieten, mag der Gedanke an einen analogen Weltempfänger zunächst antiquiert wirken. Doch weit gefehlt! Hinter den verchromten Knöpfen und den leuchtenden Skalen dieser Geräte verbirgt sich eine faszinierende Technik und eine ganz besondere Art, Radio zu hören.
Ein Weltempfänger ist mehr als nur ein Radiogerät. Er ist ein Zeitzeuge einer Ära, in der der Kurzwellenbereich das globale Kommunikationsnetzwerk darstellte. Mit einem Weltempfänger konnten Menschen weit entfernte Länder hören, fremde Kulturen kennenlernen und sogar Nachrichten empfangen, die in ihrem eigenen Land zensiert wurden. Für viele war er ein Tor zur großen, weiten Welt.
Die Faszination des Weltempfängers liegt nicht nur in seiner historischen Bedeutung, sondern auch in der Herausforderung, ihn zu bedienen. Das Einstellen der richtigen Frequenz, das Filtern von Störsignalen und das Deuten der Morsezeichen sind Aufgaben, die Geduld und technisches Verständnis erfordern. Doch gerade diese Herausforderung macht den Reiz aus. Es ist wie eine Schatzsuche, bei der man nie weiß, welche unerwarteten Klänge man entdecken wird.
Obwohl die Bedeutung des Kurzwellenbereichs in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen ist, erfreuen sich Weltempfänger auch heute noch großer Beliebtheit. Sammler schätzen sie als technische Meisterwerke, Radioamateure nutzen sie für den weltweiten Kontakt und Kurzwellenhörer genießen die besondere Atmosphäre des analogen Rundfunks.
Ein Weltempfänger ist ein Radio, das in der Lage ist, Kurzwellenrundfunk (KW-Hörfunk) zu empfangen. Aus diesem Grund wird er auch Kurzwellenradio genannt. Dabei handelt es sich um Rundfunk, der auf Kurzwellen in einem Frequenzbereich von 3 bis 30 MHz verbreitet wird. Der Name Weltempfänger rührt daher, dass Kurzwellenhörfunk weltweit empfangen werden kann. Die Kurzwellen werden von der Ionosphäre, die sich in 60 bis 1000 Kilometern Höhe befindet und sehr viele Elektronen und Ionen enthält, reflektiert. Dadurch können sie Entfernungen von mehreren Tausend Kilometern überwinden.
Ganz anders verhält es sich mit UKW-Rundfunk (Ultrakurzwellenrundfunk). Über den werden lokale beziehungsweise regionale Radiosender übertragen, weil die Reichweite im Vergleich zu Kurzwellen sehr begrenzt ist. Sie beträgt im Regelfall nur wenige Hundert Kilometer. Deshalb ist beispielsweise ein Empfang von bayerischen Radiosendern in Berlin über Rundfunk nicht möglich, wenn sie per UKW gesendet werden.
UKW-Hörfunk kann jedes Radio empfangen, für KW-Signale braucht man aber einen Weltempfänger. Daneben gibt es noch Mittel- und Langwellenrundfunk (MW und LW), die in Sachen Reichweite zwischen UKW und KW liegen. Weltempfänger empfangen in der Regel auch diese Frequenzbänder.
Noch vor dem Ersten Weltkrieg nutzten Amateurfunker selbstgebaute Kurzwellenempfänger. Erste Radio-Weltempfänger, die für die breite Öffentlichkeit verfügbar waren, gab es dann in den 1920ern. Anfangs wurden sie noch nicht als eigenständige Geräte verkauft. Stattdessen gab es Kurzwellen-Frequenzwandler als Zubehör für normale Radios. Die Empfangsqualität war jedoch nicht sehr zufriedenstellend, weshalb die Konverter kurz darauf von speziellen Kurzwellenempfangsgeräten abgelöst wurden. Mehrere Hersteller brachten Weltempfänger auf den Markt, darunter die National Radio Company und Hammarlund – beides US-Unternehmen, die es längst nicht mehr gibt. In Deutschland produzierte Telefunken die ersten Kurzwellenempfänger.
Während der Zeit des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Kriegs wurde der Kurzwellenrundfunk vielfach als Propagandainstrument genutzt. Am 1. April 1933 ging der Deutsche Kurzwellensender auf Sendung, ein Rundfunkprogramm für das Ausland, das weltweit bis kurz vor Kriegsende empfangbar war und ab 1938 in zwölf Sprachen ausgestrahlt wurde. Während des Weltkriegs nutzten sowohl die Deutschen als auch die Alliierten den Kurzwellenrundfunk, um Desinformationen zu verbreiten. Rundfunkanstalten wie die BBC ermöglichten es der deutschen Bevölkerung aber auch, über Kurzwelle ungeschönte Informationen über den Kriegsverlauf zu erhalten. Die Nazis stellten das Hören von sogenannten "Feindsendern" unter Strafe, teilweise wurden sogar Todesurteile verhängt.
Zur Zeit des des Kalten Krieges betrieben sowohl die westlichen Länder als auch die Sowjets Auslandsprogramme, um darüber eigene Ideologien in der Welt zu verbreiten. Die USA strahlten antikommunistische Sendungen in osteuropäischen Sprachen über Radio Free Europe / Radio Liberty aus. Zugleich drohten US-Amerikanern in der McCarthy-Ära Konsequenzen, wenn sie Ostblocksender hörten, weil das als "antiamerikanisch" galt. Genauso war es aber auch den Menschen in den stalinistisch geprägten Ländern verboten, ausländische Radioprogramme zu konsumieren. Mit Störsendern, die Geräusche wie Rauschen und Pfeifen auf denselben Kurzwellenfrequenzen sendeten, blockierte man die Sender aus dem Westen. In der DDR waren Weltempfänger sehr beliebt, weil sie es ermöglichten, ausländische Radiosender wie BBC, Voice of America und den Deutschlandfunk zu hören. So erhielt man zum einen unverfälschte Nachrichten und kam zum anderen in den Genuss von Musik, die in den staatlich kontrollierten Programmen nicht gespielt wurde. Allerdings waren Weltempfänger in der DDR ein rares und somit teures Gut. Manche Leute modifizierten daher ihre Radios, um westliche Sender empfangen zu können.
Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Aufkommen des Internets nahm die Bedeutung der Kurzwellenradiosender und damit auch der Weltempfänger ab. Viele Rundfunkanstalten stellten den Betrieb von Kurzwellenhörfunksendungen ein. 2022 kam es jedoch zu einer Renaissance der Kurzwellensender, leider aus einem wenig erfreulichen Anlass: der russischen Invasion in die Ukraine. Um Hörer und Hörerinnen im Kriegsgebiet und in Teilen Russlands (wegen der russischen Zensur) zu erreichen, begann die BBC wieder mit Kurzwellensendungen – 14 Jahre, nachdem man sich davon in Europa verabschiedet hatte. Auch Voice of America und Radio Free Europe / Radio Liberty senden mittlerweile wieder per KW in Russland, damit die dortige Bevölkerung mit Informationen versorgt wird, die nicht von der russischen Regierung zensiert und verfälscht werden – für den Fall, dass der Zugang zum Internet eingeschränkt oder in Gänze gesperrt wird.
Beim Kauf eines Weltempfängers steht an erster Stelle, welche Frequenzen er abdeckt. Nicht jedes Gerät kann alle Arten analogen Rundfunks empfangen, also neben KW- auch UKW-, MW- und LW-Sender. Manche sind allerdings in der Lage, auch SSB-Signale (Einseitenbandmodulation) zu empfangen und zu dekodieren. Die SSB-Technik wird sowohl von Amateurfunkern als auch für den Seefunk und beim Militär sowie in der Luftfahrt für die zuverlässige Kommunikation verwendet. Ein breites Spektrum an empfangbaren Frequenzen ist ein großer Pluspunkt.
Weitere wichtige Kriterien sind die Empfindlichkeit und Selektivität, da sie großen Einfluss auf die Empfangsqualität haben. Eine hohe Empfindlichkeit bedeutet, dass das Radio auch schwache Signale auswerten kann, während eine gute Selektivität bedeutet, dass der Weltempfänger Signale effektiv voneinander trennt. Auf diese Weise wird vermieden, dass benachbarte Signale den Empfang eines Programms stören und mehrere Sendungen gleichzeitig zu hören sind.
Zwar sind Weltempfänger auf den Empfang von analogem Hörfunk spezialisiert, nichtsdestoweniger sind sie heute standardmäßig als Digitalradios ausgeführt. Die großen Vorteile gegenüber analogen Geräten: Die Frequenz lässt sich viel präziser einstellen und Sie haben die Möglichkeit, mehrere Sender einzuspeichern, so dass Sie die jeweiligen Frequenzen nicht immer händisch eingeben müssen. Zusätzlich verfügt ein Digitalradio über ein digitales Display, das alle wichtigen Informationen anzeigt: Welcher Sender ist gerade eingestellt? Welche Frequenz ist ausgewählt? Wie viel Uhr ist es? Apropos: Ein digitaler Weltempfänger ist auch als Wecker verwendbar.
Bei jeder Art von Radio ist relevant, auf welche Weise der Ton ausgegeben wird. Ein eingebauter Lautsprecher gehört zur Grundausstattung eines Weltempfängers, allerdings gibt es hierbei Qualitätsunterschiede. Die beste Audio-Qualität erhalten Sie sicherlich, wenn Sie Kopfhörer oder externe Lautsprecher anschließen. Für den Anschluss von Kopfhörern sollte ein 3,5-mm-Klinkenanschluss vorhanden sein. Für den Anschluss von externen Lautsprechern ist ein Line-Out-Anschluss besser, der Ihnen zusätzlich die Möglichkeit bietet, mit Extra-Hardware Sendungen aufzuzeichnen. Eine Alternative hierfür ist mitunter USB: Manche Weltempfänger haben einen USB-Port, an den sich ein Gerät zur Tonaufnahme, aber beispielsweise auch USB-Kopfhörer anschließen lassen. Auch ein kabelloser Anschluss ist möglich, wenn Kopfhörer und Weltempfänger Bluetooth unterstützen.
Weltempfänger lassen sich direkt per Kabel an eine Stromquelle anschließen. Da auch eine Nutzung unterwegs möglich sein soll, besteht meist zusätzlich die Option eines Akku- oder Batteriebetriebs. Batterien müssen nachgekauft, Akkus aufgeladen werden. Wie häufig das zu geschehen hat, hängt von der Kapazität der Energiespeicher und der Nutzungsintensität ab. Für den Einsatz in der freien Natur fernab der Zivilisation empfiehlt sich ein Kurbelradio, auch Notfallradio genannt. Dessen Akku lässt sich nicht nur per Kabel aufladen, sondern über die namensgebende Handkurbel. Indem man die Kurbel betätigt, entsteht mechanische Energie, die als elektrische Energie im Akku gespeichert wird. Somit sind Sie unabhängig von anderen Stromquellen. Oft bieten Notfallradios noch ein Panel, um solar Energie zu gewinnen, und eine integrierte Taschenlampe.
Wenn das Gerät für den mobilen Einsatz vorgesehen ist, sollte es nicht zu groß und nicht zu schwer sein, damit es sich als tragbares Radio eignet und Sie es gut in der Tasche unterbringen können (Stichwort Kofferradio oder Taschenradio). Außerdem spielen eine robuste Verarbeitung und eine wasserdichte Bauweise eine große Rolle. Anderenfalls kann ein Sturz oder ein Regenschauer schon das Ende des Radios bedeuten.
Um die Empfangsqualität eines Weltempfängers zu steigern, können Sie eine externe Antenne nutzen. Manchmal liegt eine solche dem Radio schon bei. Für die Nutzung in urbanen Gegenden, in denen der Störpegel tendenziell hoch ist, empfiehlt sich eine aktive Antenne mit eingebautem Signalverstärker.
Was bedeuten FM und AM?
Nutzer und Nutzerinnen von Radios stoßen schnell auf diese beiden Abkürzungen. FM steht für Frequenzmodulation. Dabei handelt es sich um ein Modulationsverfahren, bei dem die Trägerfrequenz durch das Modulationssignal, das die zu übertragenden Informationen umfasst, verändert wird. Dessen Amplitude, die maximale Auslenkung der Frequenzschwingung aus dem arithmetischen Mittelwert heraus, bleibt aber gleich. Dem gegenüber steht die Amplitudenmodulation, kurz AM. Wie der Name es schon sagt, wird hierbei die Amplitude verändert, was zu unterschiedlich starken Schwingungen führt. Das AM-Verfahren kommt beim Senden von Kurz-, Mittel- und Langwellenrundfunk (KW, MW, LW) zum Einsatz, während FM für UKW-Hörfunk verwendet wird. Sein großer Vorteil ist eine geringere Störanfälligkeit und die damit verbundene bessere Tonqualität.
Können Weltempfänger auch DAB-Radio empfangen?
Weltempfänger-Radios sind für den Empfang von analogen AM- und FM-Signalen (KW, MW, LW, UKW) konzipiert. Auch wenn es digitale Weltempfänger gibt, für den Empfang von DAB-Radio (DAB steht für Digital Audio Broadcasting) sind sie nicht ausgelegt.